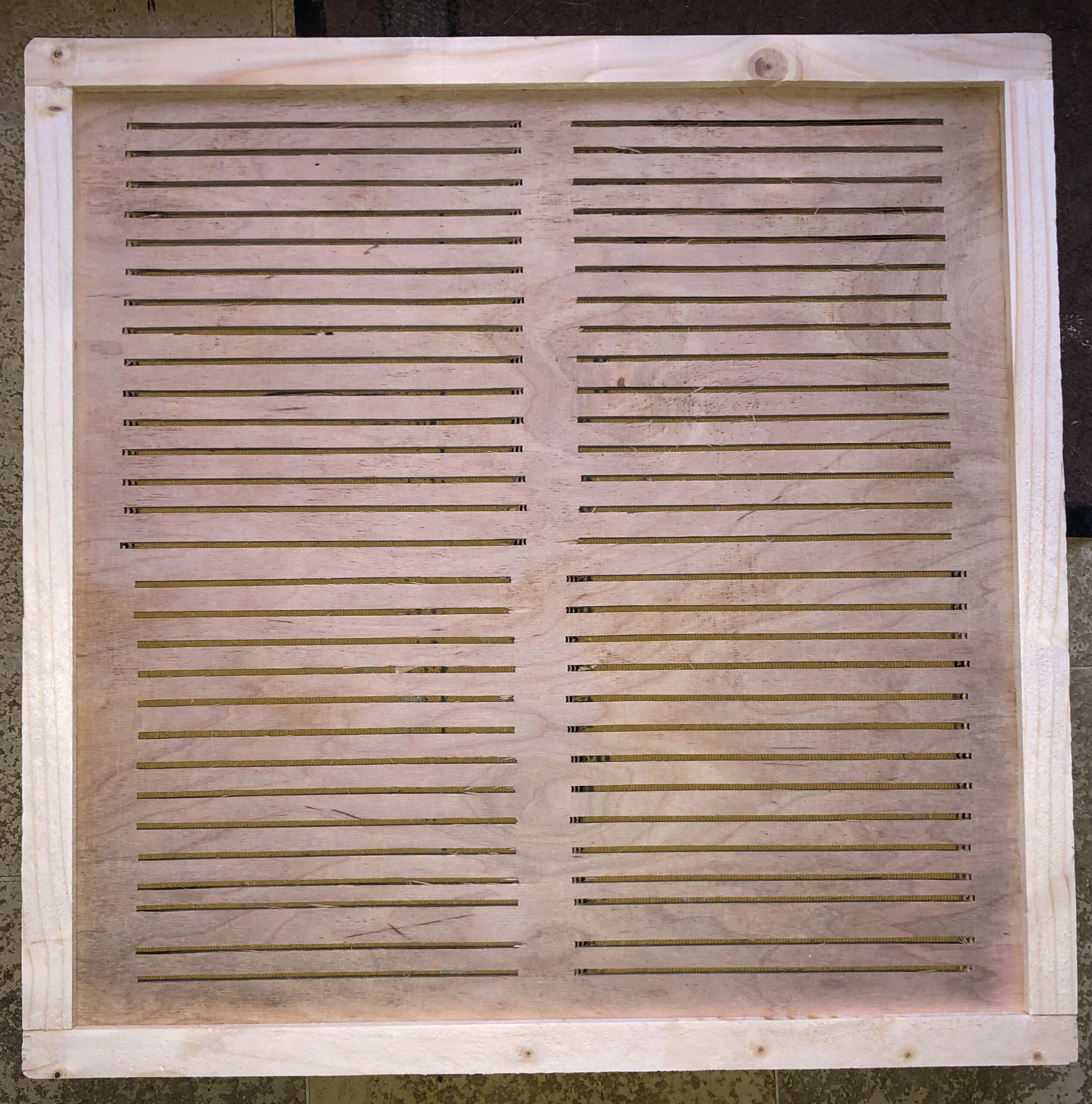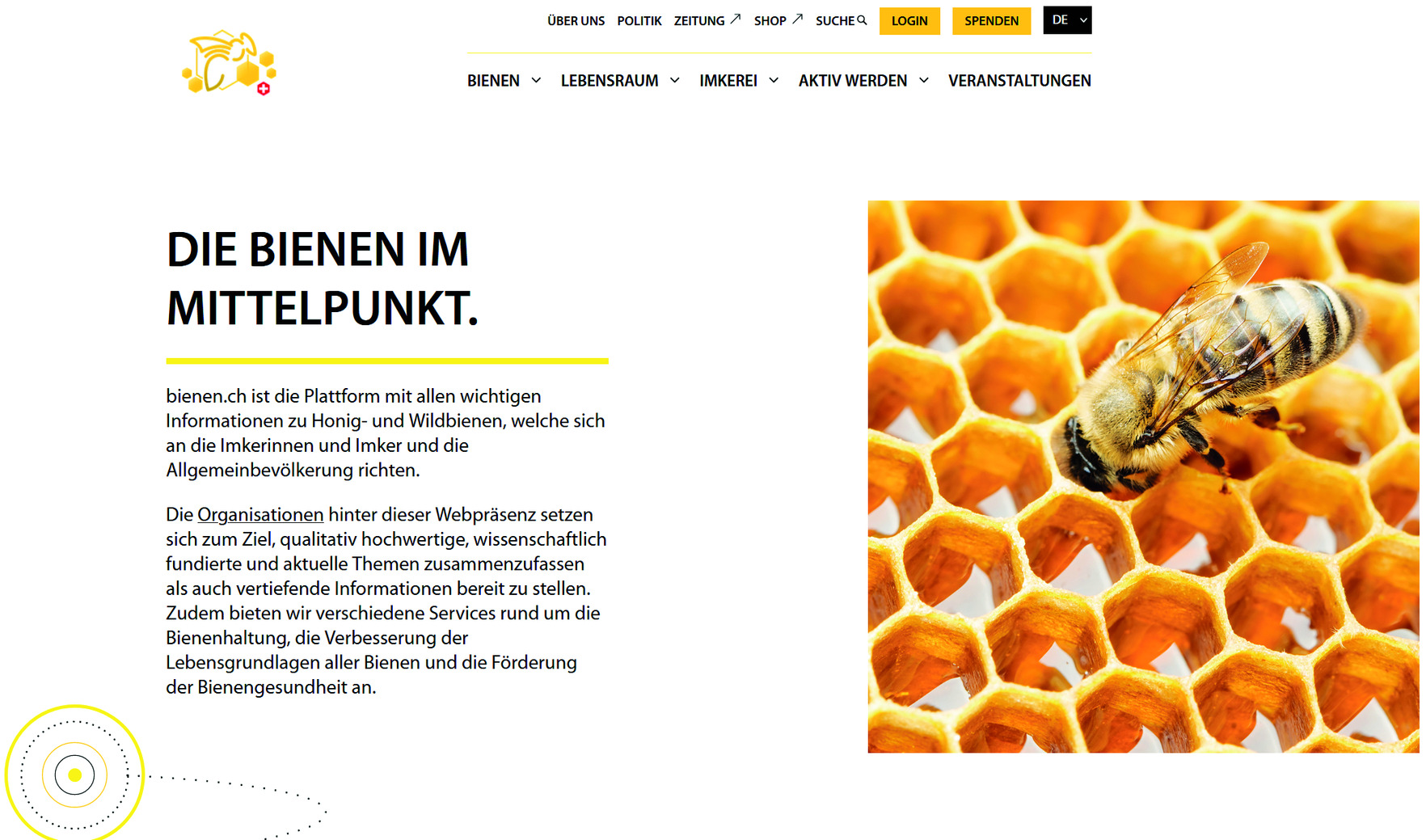Durch die Anpassungen der Beute an das Vorbild der Baumhöhle können wir unsere Bienenvölker in ihrer Frühjahresentwicklung unterstützen.
Markus Röck; Elektronik Ingenieur, Ravensburg, (markus.roeck.rv@gmail.com)
Die sichere Überwinterung der Honigbiene beschäftigt die Imker seit Jahrhunderten weltweit. Besonders in kälteren Klimazonen machten sich die Imker/-innen schon immer intensiv Gedanken über den Schutz der Bienen in der kalten Jahreszeit.
Das natürliche Habitat der Honigbiene ist die Baumhöhle. Um ein besseres Verständnis der für die Überwinterung notwendigen Rahmenbedingungen zu erlangen, ist es sinnvoll, sich näher mit der Baumhöhle zu beschäftigen.
Das Habitat Baumhöhle
Eine Baumhöhle ist in der Regel ein länglicher hohler Zylinder in der Mitte des Baumes (siehe Grafik rechts). Dabei ist die Isolierung an den Wänden und von oben dank dicker Holzwände (> 10 cm) sehr gut. Der Eingang liegt meist im unteren Bereich des Zylinders.
Thomas D. Seeley und Roger A. Morse haben 17 Bienennester in Baumhöhlen mit einer Querschnittsfläche im Mittel von 404 cm² (minimal 181 cm², maximal 1432 cm²) vermessen.1 Rechnet man die mittlere Querschnittsfläche auf einen Kreis um, so erhält man einen Durchmesser von ungefähr 22 cm. Abbé Warré versuchte schon um 1920 dieses Baumhabitat mit seiner Warré-Beute nachzubilden. Er meinte «… die Beute soll im Winter von eingeschränkter Dimension sein …».2 Die Warré-Beute hat eine Querschnittsfläche von 900 cm² (30 cm × 30 cm) und kommt dem Habitat Baumhöhle im Vergleich zu anderen Beutensystemen am nächsten.
Besonders wichtig ist die Konvektion (Luftströmung) innerhalb der Behausung der Bienen. Während ein Luftstrom Energie (Wärme) transportiert, ist stehende Luft ein guter Isolator.
Der Querschnitt einer Baumhöhle ist meist so gering (im Durchschnitt beträgt der Durchmesser 22 cm), dass die Bienen in der Wintertraube den Querschnitt vollständig abdichten können und so eine Luftkonvektion um die Wintertraube verhindern. Durch den geringen Querschnitt des Baumes können die Bienen sogar die dicken Holzwände des Baumes als Isolation ihrer Wintertraube nutzen und müssen so nur die Oberfläche nach unten isolieren: Oberhalb der Wintertraube ist stehende