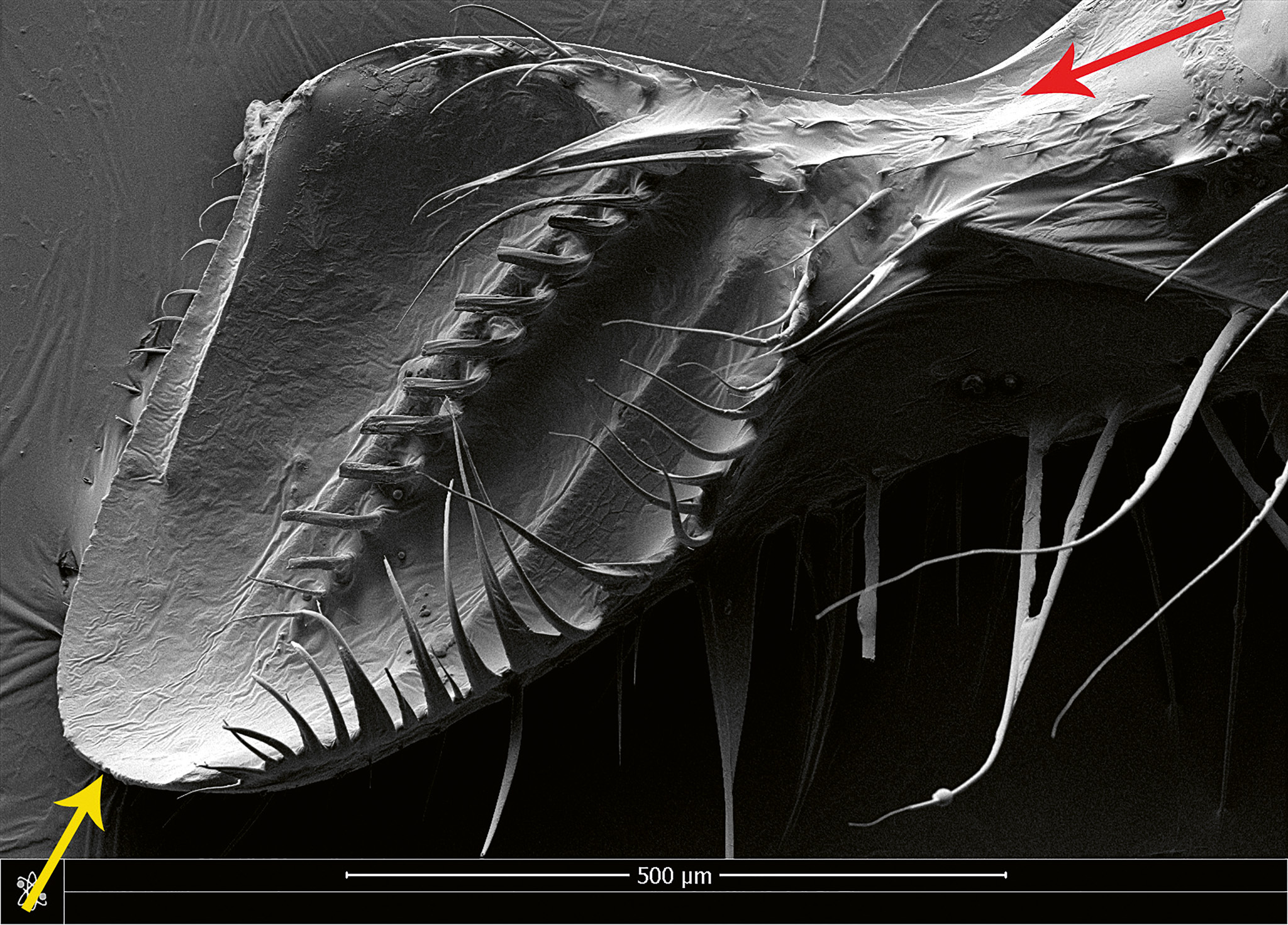Die Honigbiene selbst zählt nicht zu den gefährdeten Tierarten, einzelne Unterarten schon. Durch gezielte Schutzgebiete und Zuchtprogramme wird in der Schweiz der Fortbestand der Dunklen Biene gesichert
Ursprünglich war die Dunkle Honigbiene (Apis mellifera mellifera) vom Atlantik bis zum Ural und in der Schweiz auf der Alpennordseite als einzige Unterart verbreitet. Von Italien bis ins Tessin war die Ligustica (Apis mellifera ligustica) heimisch. Ende des 19. Jahrhunderts brachten Imker Schwärme und später Königinnen von anderen Unterarten in die Schweiz, vor allem Ligustica aus dem Tessin und Carnica, die «Krainerbiene» (Apis mellifera carnica), aus Österreich. Ab dem Jahr 1897 formierte sich unter der Leitung von Dr. U. Kramer und dem VDSB, dem Vorgänger von BienenSchweiz, eine Gegenbewegung. Ziel war es, die ursprüngliche Dunkle Landrasse zu bewahren und weiter zu züchten. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts gelang dies auch weitgehend.

Der Druck wächst
Nach dem Zweiten Weltkrieg stellten die deutschen Belegstationen und Bieneninstitute nach und nach auf die Zucht der Carnica um. Dadurch wurde die ursprünglich einheimische Dunkle Biene fast völlig verdrängt. Auch in der Schweiz nahm der Druck von Norden und Osten her zu. Besonders in den Frühtrachtgebieten erwiesen sich Carnica-Zuchtvölker als erfolgreicher.
Hybridbildungen
Erst seit einigen Jahrzehnten sind zwei wesentliche Eigenheiten über die Begattung der Honigbienen bekannt:
- Bienenköniginnen werden im Begattungsflug von mehreren Drohnen – etwa einem Dutzend – begattet.
- Diese Begattungsflüge finden an Drohnensammelplätzen statt, die mehrere Kilometer weit entfernt sein können.
Da die väterliche Abstammung in der nächsten Generation meist unbekannt ist und der Handel mit Bienenvölkern und Königinnen eine Durchmischung verschiedener Unterarten fördert, kam es in ganz Europa zu Hybridbildungen. Während diese in der ersten Generation oft besonders vital sind, zeigen sie in den Folgegenerationen häufig unerwünschte Eigenschaften. Bruder Adam trat die Flucht nach vorne an und begründete die Kreuzungszucht Buckfast, die auch in der Schweiz mehr und mehr gehalten wird.
Viele Länder erkannten bald, dass es besondere Anstrengungen braucht, um die ursprünglichen einheimischen Unterarten zu erhalten. Dazu gehören sichere Belegstationen, Besamung und Schutzgebiete, in denen nur eine Bienenart gehalten werden darf. Diese kann sich dort auf natürliche Art verpaaren und fortpflanzen. So erklärte Österreich etwa das Bundesland Kärnten zum Schutzgebiet für die vielfach exportierte Carnica. Auch in Italien entstanden Schutzgebiete für die Ligustica. Für die Dunkle Biene gibt es mittlerweile in vielen Ländern Schutzgebiete.
Der Kanton Glarus als Schutzgebiet der Dunklen Biene
In der Schweiz entstand im Kanton Glarus das erste Schutzgebiet der Dunklen Biene. In den Jahren 1977/78 verbot die Landsgemeinde per Beschluss die Einfuhr fremder Bienenrassen. Von da an durfte im Kanton Glarus ausschliesslich die Apis mellifera mellifera gehalten werden. Der Auslöser für diesen Beschluss war die drohende Varroainvasion.
Ab 2005 leitete Christian Rickenbach ein Projekt des VDRB. Bis ins Jahr 2008 wurden in allen Gebieten vom Sernftal bis ins Mittelland systematische Flügelmessungen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Mellifera in den südlichen Kantonsteilen noch rein erhalten war. In der Folge wurden Hybridvölker in den nördlichen Gebieten umgeweiselt.
Der Kanton erklärte die Gebiete der beiden Belegstationen Krauchtal und Klöntal zu besonderen Schutzgebieten, in denen keine anderen Bienen gehalten werden durften. Doch ab 2011 wurden im Klöntal Einflüsse einer Buckfast-Belegstelle festgestellt. Verschiedene Gespräche führten zu keinem Ergebnis und der Verein Glarner Bienenfreunde entschloss sich, die Belegstation Klöntal nach über hundertjährigem Betrieb aufzugeben und im Sernftal eine neue Station zu errichten. Die beiden Belegstationen Krauchtal und Sernftal werden von Glarner Imker/-innen und Züchter/-innen aus der ganzen Schweiz genutzt.

Weitere Schutzgebiete
Es gibt aber noch weitere Schutzgebiete: Im Jahr 2013 erklärte der Kanton Obwalden das Melchtal zum Schutzgebiet für die Dunkle Biene. Die dort gehaltenen rund 50 Bienenvölker dienen gleichzeitig als Drohnenvölker der Belegstation. Ziel ist es, eine eigenständige Population zu erhalten. Im Zuge der Schaffung von Naturparks setzten sich die örtlichen Imkervereine im Diemtigtal (BE) und im Münstertal (GR) für die Einrichtung von Schutzgebieten ein.
Die Schweiz verpflichtet sich durch das Natur- und Heimatschutzgesetz sowie durch den Beitritt zur Konvention von Rio, einheimische Tier- und Pflanzenarten zu schützen und vor dem Aussterben zu bewahren. Konkret sieht die Tierzuchtverordnung Beiträge für die «Durchführung von Projekten zur Erhaltung der Schweizer Rassen» vor.
Den lokalen Ökotyp erhalten und fördern
Unter dem Dach von apisuisse und der Leitung der Zuchtstelle unter Ruedi Ritter sowie mellifera.ch mit Dr. Padruot Fried und Dr. Gabriele Soland wurde 2014 das Projekt «Pflege und Erhalt der gefährdeten Dunklen Biene in der Schweiz in vier Schutzgebieten» ins Leben gerufen. Ziel war es, den lokalen, einheimischen Ökotyp der Mellifera für künftige Generationen zu erhalten und zu fördern. Der Fokus lag auf der Identifikation reiner Populationen, um mittels Vermehrung reiner Königinnen hybridisierte Völker durch rassetypische Königinnen zu ersetzen. Das Projekt wurde vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) mit finanziellen Beiträgen für die visuellen Kontrollen, Hybridanalysen, Umweiselungen, vergünstigten Abgaben von rassetypischen Königinnen und Jungvölkern unterstützt. Nach drei erfolgreichen Jahren konnte das Projekt um weitere drei Jahre verlängert werden.
Herausforderungen im Münstertal und Diemtigtal
Während der zweiten Projektperiode zeichnete sich in den nicht rechtlich geschützten Gebieten Münstertal und Diemtigtal eine Wende ab. In beiden Gebieten gab es einzelne Imker, die teils offen, teils heimlich, gegen die Absicht der Vereinsleitungen und der überwiegenden Mehrheit der Bienenhaltenden handelten. So wurden Bestrebungen, flächendeckend die Dunkle Biene rassetypisch und imkertauglich zu erhalten, immer wieder zunichtegemacht. Die Gebiete konnten deshalb für ein Folgeprojekt nicht mehr auf diese Weise unterstützt werden. Für das Diemtigtal konnte für das Gebiet der Belegstation Beret im Jahre 2022 eine rechtliche Schutzzone geschaffen werden. Die Bestrebungen zum Erhalt der Dunklen Biene im Diemtigtal und Münstertal werden von den örtlichen Vereinen weitergeführt und durch den Naturpark oder die Biosfera unterstützt.
Für die Gebiete Glarus und Melchtal konnte das vom BLW unterstützte Projekt mit einzelnen Anpassungen nochmals von 2021 bis 2023 verlängert werden.

Erfolge des Schutzprojektes
Von 2015 bis 2023 wurden im Rahmen des Schutzprojektes 1117 visuelle Kontrollen und 640 genetische Hybridtests durchgeführt. 1395 Königinnen wurden lokal produziert. Zudem fanden 906 Umweiselungen (inklusive Jungvolkbildung) mit rassetypischen Königinnen statt. Hinter diesen Zahlen steckt nebst der finanziellen Unterstützung durch das BLW ein immenses Engagement vieler Imkerinnen und Imker, Vereinsfunktionären und Wissenschaftler/-innen. Allen Beteiligten gebührt ein grosser Dank. Folgende Personen sind besonders zu erwähnen: Jürg Glanzmann und Raphael Giossi (Projektleitung apisuisse), Georg Roller (Glarus) und Irene Burch (Melchtal).
- Im Melchtal konnte die Melliferapopulation stabilisiert werden.
- Im Kanton Glarus, mit fast 1000 Bienenvölkern, konnte eine ursprüngliche Melliferapopulation erhalten werden. Nach neuen genetischen Untersuchungen von Dr. Vanessa Huml ist der überwiegende Teil der Völker melliferatypisch. Die Hybridisierung von den offenen Rändern her wurde erfolgreich aufgehalten.
- Sowohl in Glarus als auch im Melchtal findet eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Züchtern und Belegstationen innerhalb und ausserhalb der Schutzgebiete statt.
Zwei Säulen für die Zukunft: Schutzgebiete und Zucht
Die Erhaltung von mehr als 20 Unterarten der Westlichen Honigbiene in ihren Ursprungsgebieten ist ethisch gut begründet. Dabei tragen Imkerinnen und Imker eine grosse Verantwortung. Die grösste Gefahr für einheimische Bienen ist die Hybridisierung. Was einmal hybridisiert ist – wie die Ligustica im Tessin – kann nicht mehr für die Erhaltungszucht genutzt werden.
Die Erhaltung der Dunklen Schweizerbiene basiert auf zwei Säulen: Schutzgebiete und Zucht. Beide sind unverzichtbar und ergänzen sich. Bei der kontrollierten Begattung durch Belegstationen und Besamung darf die Zucht nicht in einem genetischen Flaschenhals münden. Wir wissen nicht, welche Herausforderungen die Zukunft für die Bienen bereithält und welche genetischen Merkmale dann notwendig sind.
Gut gepflegte Schutzgebiete können ein wertvolles Genreservoir bieten. Ohne aktive Zucht wären sie jedoch noch stärker bedroht. Vor allem die Glarner Bienenpopulation bildet ein genetisches Reservoir einer ursprünglichen, frei angepaarten Mellifera-Biene. Neuere Untersuchungen von Dr. Markus Neuditschko, Dr. Matthieu Guichard und Dr. Vanessa Huml zeigen deutliche genetische Unterschiede zur Zuchtpopulation der Schweizer Mellifera. Diesen Schatz müssen wir erhalten. Die Bundesbehörden konnten eine erneute Verlängerung des Projektes in den Schutzgebieten nicht mehr bewilligen. Der Verein der Glarner Bienenfreunde hat an der Generalversammlung vom März 2024 die Weiterführung verschiedener Massnahmen zum Schutz der einheimischen Biene beschlossen. Auf die Länge kann der Verein die finanziellen Mittel aber nicht aufbringen. Es braucht Geld von anderer Seite. Das gilt auch für die kleineren Schutzgebiete.

Literatur
- Rickenbach, C. (2011) Schutzgebiet Apis mellifera mellifera Glarnerland. mellifera.ch 2: 15–17.
- Bott, R. (2011) Schutzgebiet Apis mellifera mellifera Münstertal. mellifera.ch 2: 18–19.
- Wissler, C. (2011) Schutzgebiet Apis mellifera mellifera Diemtigtal. mellifera.ch 2: 20.
- Fried, B. (2018) Schutzgebiete – nachhaltige Erhaltung unserer Dunklen Biene. mellifera.ch 1: 22–35.
- Elen, D. et al. (2018) Statement of principle on the need for EU rules to protect the subspecies. Pollinis (https://www.pollinis.org/publications/statement-of-principle-protection-on-subspecies-and-ecotypes-of-honey-bees/)
- Parejo, M; Dietemann, V.; Praz, Chr. (2021) Der Status freilebender Völker der Dunklen Honigbiene (Apis mellifera mellifera) in der Schweiz – Literatursynthese und Expertenempfehlungen. Bericht Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bern/Neuchâtel. (https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/externe-studien-berichte/der-status-freilebender-voelker-der-dunklen-honigbiene-in-der-schweiz.pdf.download.pdf/Status-freilebender-V%C3%B6lker_Dunkle_Honigbiene.pdf)